Arsenstoffwechsel komplexer als vermutet?
Organische Arsen-Schwefel-Verbindung in Schafsurin entdeckt
Wenn im Krimi von "Arsen" die Rede ist, wurde das Opfer meist mit Arsenik, d.h. Arsenoxid, vergiftet. Wie giftig eine arsenhaltige Substanz ist, hängt von ihrem genauen Aufbau. Im Urin einer seltenen Schafsrasse fanden Forscher der Universitäten Aberdeen, Schottland, und York, England, eine bisher unbekannte organische Arsenverbindung. Das Besondere daran: An das Arsenatom ist ein Schwefelatom gebunden - das erste Mal, dass ein Thioorganoarsenat, so der Name dieser Verbindungsklasse (griech. theion = Schwefel), in einer biologischen Probe gefunden wurde.
"Überraschend, aber eigentlich nicht unerwartet," findet Jörg Feldmann, "denn Arsen hat eine hohe Affinität zu Schwefel, im Organismus binden Arsenionen an Schwefelwasserstoffgruppen von Proteinen und legen so wichtige physiologische Funktionen lahm. Auch beim Abbau von arsenhaltigen Verbindungen im Körper spielt die Bindung zwischen Arsen- und Schwefelatomen eine wichtige Rolle." Auf der Suche nach arsenhaltigen Stoffwechselprodukten untersuchten er und seine Kollegen den Urin einer britischen Schafsart, deren Lieblingsspeise Seegras ist. Seegras akkumuliert Arsen, das in Meerwasser in Spuren vorhanden ist, in Form von so genannten Arsenozuckern, einer bisher als nichttoxisch eingestuften Verbindungsklasse. Das Thioorganoarsenat, dessen Struktur durch chromatographische und massenspektrometrische Methoden charakterisiert wurde, ist nicht sehr beständig, vielleicht einer der Gründe, warum es jetzt erst entdeckt wurde. Beim längeren Stehenlassen und bei der Behandlung der Proben wird es rasch in das entsprechende Oxoorganoarsenat umgewandelt, das Schwefel- also durch ein Sauerstoffatom ersetzt. Die Oxo-Verbindung ist bereits seit längerem bekannt, sie soll in Schalentieren vorkommen und galt bisher als Metabolit von Arsenozuckern, der mit dem Urin ausgeschieden wird.
Möglicherweise wurden Thioorganoarsenate bei der Analytik von Bioproben bisher einfach übersehen. Feldmann: "Die Standardbedingungen bei der Analytik von Arsenverbindungen scheinen für den Nachweis von Thioorganoarsenaten sehr ungünstig zu sein." Beispielsweise spielt der pH-Wert (Säurewert) bei der Trennung der Proben auf Chromatographie-Säulen eine wichtige Rolle. In stark sauren Lösungen zersetzt sich das in Schafsurin gefundene Thioorganoarsenat leicht, mit nur schwach sauren Flüssigkeiten lässt es sich nicht mehr von der Säule eluieren. "Mit diesem Wissen könnte vielleicht bald eine Vielzahl weiterer Thioorganoarsen-Verbindungen entdeckt werden," spekuliert Feldmann. "Der Stoffwechsel von Arsenverbindungen im Körper scheint jedenfalls komplexer zu sein als zuvor angenommen, und es eröffnen sich neue Fragen zur Toxizität von Arsenverbidnungen."
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Meistgelesene News
Weitere News von unseren anderen Portalen
Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten
Themenwelt Chromatographie
Mit Hilfe der Chromatographie können wir komplexe Substanzen trennen, identifizieren und so verstehen. Ob in der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen Forschung oder der Umweltanalytik – Chromatographie eröffnet uns eine Schatzkammer an Informationen über die Zusammensetzung und Qualität unserer Proben. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Chromatographie!
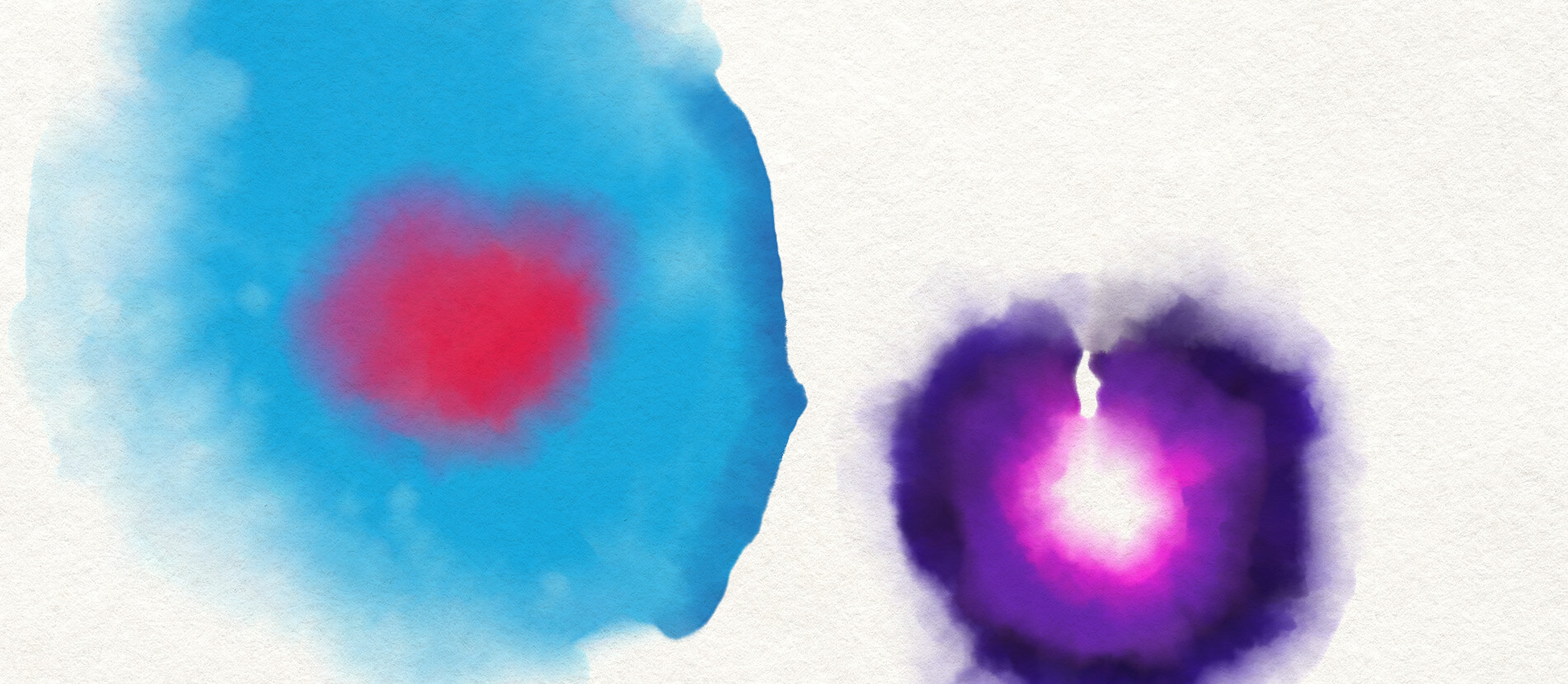
Themenwelt Chromatographie
Mit Hilfe der Chromatographie können wir komplexe Substanzen trennen, identifizieren und so verstehen. Ob in der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen Forschung oder der Umweltanalytik – Chromatographie eröffnet uns eine Schatzkammer an Informationen über die Zusammensetzung und Qualität unserer Proben. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Chromatographie!























































